 Zauberpflanzen: Vom Zauber der Pflanzen - einst und heute
Zauberpflanzen: Vom Zauber der Pflanzen - einst und heute für
für 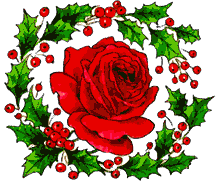 und
und  Literaturfreunde
Literaturfreunde Inhalt Adventskalender von A-Z: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ
 Zauberpflanzen: Vom Zauber der Pflanzen - einst und heute
Zauberpflanzen: Vom Zauber der Pflanzen - einst und heute für
für 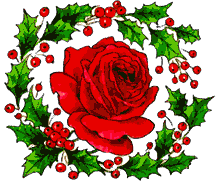 und
und  Literaturfreunde
Literaturfreunde |
Die christlichen Symbolfarben von Advent und Weihnachten - sowohl im Adventskranz als auch beim Tannenbaumschmuck sind Grün und Rot. Grün symbolisiert nicht nur die Hoffnung auf Lebenserhalt im dunklen Winter, sondern damit auch die Treue. Die Lebenskraft, die in wintergrünen Gewächsen steckte, wurde oft auch als Heilkraft gedeutet. So glaubte man sich Gesundheit ins Haus zu holen, wenn man es mit Grünem schmückte. Fichte, Tanne, Kiefer, Eibe, Buchsbaum, Ilex, Stechpalme, Stechginster, Wacholder, Efeu, Kronsbeere, Rosmarin. Dem Buchsbaum wurden dabei besondere Kräfte zugesprochen. "Wintergrün", das früher am "Elisabeth-Tag", dem 19. November schon besorgt wurde - Tannenzweige, Moos und grüne Papierstreifen - diente zur Schmückung von Kirchen, Krippen und Leuchtern. Rot erinnert an das Blut Christi, das er vergossen hat, damit die Welt erlöst werde. Die Farbkombination von Grün und Rot versinnbildlicht Christen also die übernatürliche Hoffnung. Die Farben prägen den Christbaum, die Tischdekoration (.z.B. mit dem Weihnachtsstern), Weihnachtspost und das Verpackungsmaterial der Geschenke. Zur Feier der Wintersonnenwende wurden grüne Zweige als Schutz und Zaubermittel sowie zur Beschwörung des Sommers geschlagen. In allen Kulturen und Religionen ist der immergrüne Baum Wohnsitz der Götter und damit Zeichen des Lebens gewesen. Die Sitte, grüne Tannenzweige ins Haus zu stellen, wird schon für 1494 im "Narrenschiff" Sebastian Brants bezeugt. Aus dem Jahr 1535 ist überliefert, daß in Straßburg kleine Eiben, Stechpalmen und Buchsbäumchen verkauft wurden, die noch ohne Kerzen in den Stuben aufgehängt wurden. 1605 soll es dann bereits einen mit Äpfeln geschmückten, aber noch kerzenlosen Weihnachtsbaum in Straßburg gegeben haben, der als "Gabenbaum" oder "Bescherbaum" errichtet war. Der "Christbaum" hat seinen Ursprung im mittelalterlichen Krippenspiel in der Kirche. Vor dem eigentlichen Krippenspiel fand das Paradiesspiel statt, in dem gezeigt wurde, wie durch Adam und Eva die Sünde in die Welt kam, von der wir durch Christi Kreuzestod befreit wurden. Zu diesem Spiel gehörte ein immergrüner Baum als "Paradiesbaum" (auch Adamsbaum), der mit Äpfeln geschmückt war. Mit den Jahren wurde der Paradiesbaum immer schmucker: (vergoldete) Nüsse, Festgebäck und Süßigkeiten ersetzten bzw. ergänzten nach und nach die Äpfel, um die "paradiesische" Funktion des Baumes für die Gläubigen deutlich zu machen. In "Silber"papier und in "Gold"papier eingewickelte Früchte dieses Baumes sind so zu den Vorlagen für Christbaumkugeln und Christbaumschmuck geworden. Im 16./17. Jahrhundert taucht der Paradiesbaum außerhalb der Kirche auf: bei Gemeinschaftsfeiern von Zünften und Bruderschaften. Er löste sich damit vom Krippenspiel ab, wurde Symbol der Advent- und Weihnachtszeit. Der erste kerzengeschmückte Tannenbaum schließlich ist überliefert als 1611 in Schlesien im Schloß der Herzogin Dorothea Sybille von Schlesien aufgestellt. Im 18. Jahrhundert wurde der Tannenbaum immer häufiger; so berichtet Lieselotte von der Pfalz 1708 von einem Buchsbäumchen mit Kerzen: "Ich weiß nicht, ob ihr ein anderes Spiel habt, das jetzt noch in ganz Deutschland üblich ist; man nennt es Christkindel. Da richtet man Tische wie Altäre her und stattet sie für jedes Kind mit allerlei Dingen aus, wie neue Kleider, Silberzeug, Puppen, Zuckerwerk und alles Mögliche. Auf diese Tische stellt man Buchsbäume und befestigt an jedem Zweig ein Kerzchen; das sieht allerliebst aus und ich möchte es heutzutage noch gern sehen. Ich erinnere mich, wie man mir zu Hannover das Christkindel zum letzten Mal [1662] kommen ließ". Die Lichterbäume tauchen zunächst in den Wohnstuben evangelischer Familien auf - als konfessionelles Gegensymbol zur (katholischen) Weihnachtskrippe. Der preußische König Friedrich der Große (1740 - 1786) berichtet 1755 von Tannenbäumen,an denen die Eltern "vergoldete Erdäpfel" (= Kartoffeln) aufhängen, "um den Kindern eine Gestalt von Paradiesäpfeln vorzuspiegeln". Ab 1820 stand mit dem nun erfundenen Stearin ein preisgünstiges Material statt des Bienenwachses zur Herstellung von Kerzen zur Verfügung.
 Johann Wolfgang von Goethe lernte den Weihnachtsbaum in Straßburg 1770 kennen und so ist eine der frühesten literarischen Erwähnungen in seinem "Werther" von 1774 zu finden. Auch wenn der Weihnachtsbaum schon in Berlin und Hamburg vor 1800 bezeugt ist: allgemein gebräuchlich wurde er erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Daß die Verbreitung relativ langsam vorangekommen war, hatte natürlich viel damit zu tun, daß ihn die Kirchen wegen seiner magischen Herkunft“ zunächst abgelehnt hatten. In Berlin tauchte der erste Weihnachtsbaum um 1780 auf. Für das Jahr 1813 werden die ersten Weihnachtsbaüme aus Wien und Graz gemeldet. Allgemeiner verbreitet hat sich der Christbaum in Österreich erst, seit Henriette von Nassau-Weilburg, die Gemahlin des Erzherzogs Karl (Rose 'Archiduchesse Henriette') , im Jahre 1816 das Weihnachtsfest mit einem kerzengeschmückten Weihnachtsbaum gefeiert hatte. Durch den deutschen Prinzgemahl Albert der britischen Königin Victoria (1837 - 1901) kam der Weihnachtsbaum auch nach England. Ab dem 19. und 20. Jahrhundert kommt der Tannenbaum auch in die Wohnzimmern katholischer Familien. In die Neue Welt kam der Weihnachtsbaum gewissermaßen im Reisegepäck deutscher Auswanderer. Die Nazis hätten den Christbaum gern nur noch als Weihnachts- oder Tannenbaum durchgehen lassen. Den berühmten "Londoner Weihnachtsbaum" erhalten die Engländer jedes Jahr aus Oslo zum Geschenk. Die Norweger erinnern damit jährlich an ihre gemeinsame Waffenbrüderschaft gegen die deutschen Nationalsozialisten. In DDR-Zeiten wurde angeblich auch dem Christ- bzw."Weihnachts"baum eine passende Geschichte und ein neuer Name - "Schmuckbaum" gegeben; nan erklärte seine Vergangenheit als Festbaum der Zünfte, der zum Kinderbaum geworden sei. Eben deshalb habe ihn die Sowjetunion 1935 zu Silvester als Gabenbaum eingeführt... Heute ist der Weihnachtsbaum in fast allen Häusern und Kirchen üblich, wobei die "Weihnachtstanne" übrigens meistens eine Fichte ist! Schätzungsweise 22 bis 23 Millionen Weihnachtsbäumen werden für das "Fest der Liebe" gebraucht. Die frühen Weihnachtsbäume waren behangen mit vielen Leckereien - Äpfel, Nüssen, Lebkuchen usw. - ein Stückchen Paradies oder Schlaraffenland, bei dem die Kinder es nicht abwarten konnten, ihn "abzuernten". Mit der Zeit ist ist der Weihnachtsschmuck / Christbaumschmuck dann von handwerklich oder industriell gefertigtem Schmuck aus Papier, Metall oder Glas verdrängt worden. Berühmte Christbäume stehen auf dem Petersplatz in Rom und auf dem Trafalgar Square in London. Der Papst erhält jedes Jahr einen Weihnachtsbaum für den Petersplatz zum Geschenk. Eine alte Bezeichnung für den Weihnachtsbaum in Thüringen, Hessen, Franken und in der Pfalz ist übrigens "Zuckerbaum". "Alle Koniferen, die zur Familie der Pinaceae gehören – die Kiefern (Pinus), Fichten (Picea), Douglas-Tannen (Pseudotsuga menziesii, früher P. douglasii) und sogar die Lärchen (Larix) und Goldlärchen (Pseudolarix), bieten uns köstliche Genüsse, sowohl in Form ihres jungen Grüns als auch in Gestalt ihrer interessanten Blüten zwischen den feinen Nadeln." ... Nadelbaumsirup: ... in ein Einweckglas abwechselnd kleine Büschelchen aromatischer Fichten- und / oder Tannentriebe und weißen und / oder braunen Zucker geben. Den Abschluß sollte eine Schicht Zucker bilden. Das Glas verschließen und 3 Wochen in die Sonne stellen. Es bildet sich ein aromatischer Sirup, der nur noch gefiltert werden muß. (Quelle: Lestrieux / de Belder Der Geschmack von Blumen und Blüten) Kurz noch zur Heilkraft der Tanne: Bei Bronchitis helfen die Knospen als Tee innerlich oder als Badezusatz äußerlich. Ratschläge für Kauf und Pflege Ihres WeihnachtsbaumsMehr als 27 Millionen Weihnachtsbäume schmücken zu Weihnachten die "gute Stube" in Deutschland. Die beliebteste Baumart ist seit einigen Jahren die Nordmanntanne mit über 50% (weiter steigend).Die Nordmanntanne (Abies nordmanniana) oder Edeltanne benötigt 12-15 Jahre, um Zimmerhöhe zu erreichen; deshalb ist sie mit Abstand der teuerste Baum. Sie ist keine heimische Baumart, sondern stammt aus dem Kaukasus und wird in unseren Breiten nur für Weihnachtsbaumzwecke angebaut. Sie zeichnet sich vor allem durch ihre hohe Nadelfestigkeit aus, d. h. selbst in beheizten Räumen hält sie sehr lange. Sie hat weiche, glänzend-tiefgrüne, nichtstechende Nadeln und eine gleichmäßige Wuchsform. Die Rotfichte (Picea rubens) ist der preiswerteste Weihnachtsbaum, hat aber von allen Arten die geringste Haltbarkeit, denn sie nadelt in warmen Räumen schon nach wenigen Tagen, weshalb sie erst kurz vor dem Fest frisch geschlagen werden sollte. Sie hat dunkelgrüne, nur mäßig stechende Nadeln. Die dicht stehenden Zweige sind leicht nach oben gewachsen. Die Douglasie (Pseudotsuga menziesii) stammt aus dem Bereich der pazifischen Küste Nordamerikas und wurde vor im 19. Jhdt. Jahren in Mitteleuropa heimisch gemacht. Sie hat weiche, dünne Nadeln, die einen intensiven Zitrus-Duft verströmen, dünne, biegsame Zweige und ist deshalb nur für leichten Baumschmuck geeignet. Ihre Haltbarkeit ist etwa mit der der Blaufichte zu vergleichen, preislich ist sie etwas günstiger als diese. Die Blaufichte (Picea pungens) stammt u.a. aus Nordamerika. Wie der Name schon sagt, weist sie einen großen "Blauanteil" auf. Das ist ein Schimmer auf den Baumnadeln, dessen Intensität aber nicht nur vom Typ selbst, sondern auch von der Witterung abhängig ist. Sie hat eine mittlere Haltbarkeit, liegt im Preissegment etwas über der Rotfichte, ist ein Klassiker unter den Weihnachtsbäumen und wird im Volksmund oft fälschlicherweise auch „Edeltanne“ genannt. Aufgrund ihrer starken, gleichmäßig etagenförmig gewachsenen Äste ist sie besonders für schweren Baumschmuck und für echte Kerzen geeignet.Sie hat grüne, blaugrüne oder stahlblaue starkstechende Nadeln, die stark stechen und toll nach Wald duften. Die Blautanne ist identisch mit der Blaufichte, aber ihre Nadelfestigkeit ist größer. Die Edeltanne (Abies nobilis bzw. A.procera) liegt etwa auf dem gleichen Preisniveau wie die Nordmanntanne stammt sie aus Nordamerika, ist aber noch haltbarer. Sie hat weiche, blaugrüne Nadeln, die äußerst intensiv (nach Orangen) duften und etagenförmig angeordnete Zweige. Ihren Geruch kann man noch intensivieren, wenn die am Stamm befindlichen Harztaschen (kleine Beulen) mit einer Nadel angepiekst werden. Eine Weißtanne (Abies alba) sollte man aus ökologischen Gründen nicht kaufen. Der heimische Baum mit dunkelgrünen, glänzenden, nicht stechenden Nadeln steht nämlich auf der Roten Liste der bedrohten Pflanzenarten. Wichtig zu wissen für die Haltbarkeit eines Baumes in der Wohnung: etwa 70 Prozent der Christbäume kommen aus Baumschulen des Inlandes,, wo sie bereits Anfang November (!) geschlagen werden. Der Rest kommt vor allem aus Dänemark, aber auch aus Polen und sogar Irland, haben also schon lange Transportwege hinter sich. Das heißt, daß der erworbene Baum zwischen vier bis acht Wochen „alt“ ist, wenn er am Heiligen Abend aufgestellt wird! Außerdem muß man wissen, daß sie in den Plantagen vielen und auch unterschiedlichen Chemikalien ausgesetzt werden – und zwar nicht nur Kunstdüngern, sondern vor allem Pestiziden und Herbiziden, die Krankheiten und Schädlinge abwehren sollen. Niemals den Baum auf dem Autodach nach Hause transportieren,denn durch den Fahrtwind werden den Bäumen erhebliche Mengen Wasser entzogen, die ihnen dann im warmen Zimmer fehlen. Wird der Baum dagegen in Folie oder Ballentuch eingeschlagen, hält er länger. Sägen Sie nach dem Kauf am Fuß des Baumes etwa 2 cm ab und stellen den Baum bis zum Aufstellen im Raum in einen Wassereimer an einen kühlen Platz (Terasse, Balkon, Keller, Garage); so bleibt er länger frisch. Benetzen Sie außerdem mit einem Schlauch oder einer Gießkanne 2-3 mal von oben über die Spitze den gesamten Baum. Den Baum nicht zu nahe an eine Heizung stellen und vor Zugluft schützen und den Baumständer (wenn möglich) mit Wasser füllen. Pro Liter etwa 30 ml Schnittblumen-Frischhaltemittel oder einen Esslöffel Zucker beigeben. Auch nach dem Aufstellen ist es von Vorteil, mit einem Wasserzerstäuber einmal täglich Feuchtigkeit auf die Nadeln zu bringen. Bei Bäumen mit Wurzelballen, die man anschließend in den Garten pflanzen möchte, ist das sogar unbedingt notwendig, damit die Bäume im Freien wieder anwachsen; diese sollten übrigens maximal 10 Tage im Warmen stehen. Entsorgt werden sollte entweder über die Biotonne oder die Grünschnittabfuhr. Oft sammeln auch örtliche Vereine oder städtische Unternehmen die alten Christbäume ein. Manche Baumschulen und Gärtnereien, in denem man gekauft hat, nehmen den Baum auch wieder zurück. Meist werden sie gehäckselt, kompostiert oder als Mulchschicht in öffentlichen Anlagen ausgebracht. Wichtig ist, daß dann kein Lametta oder sonstiger Christbaumschmuck mehr an den Ex-Christbäumen hängt; denn Lametta ist oftmals schwermetallhaltig. |